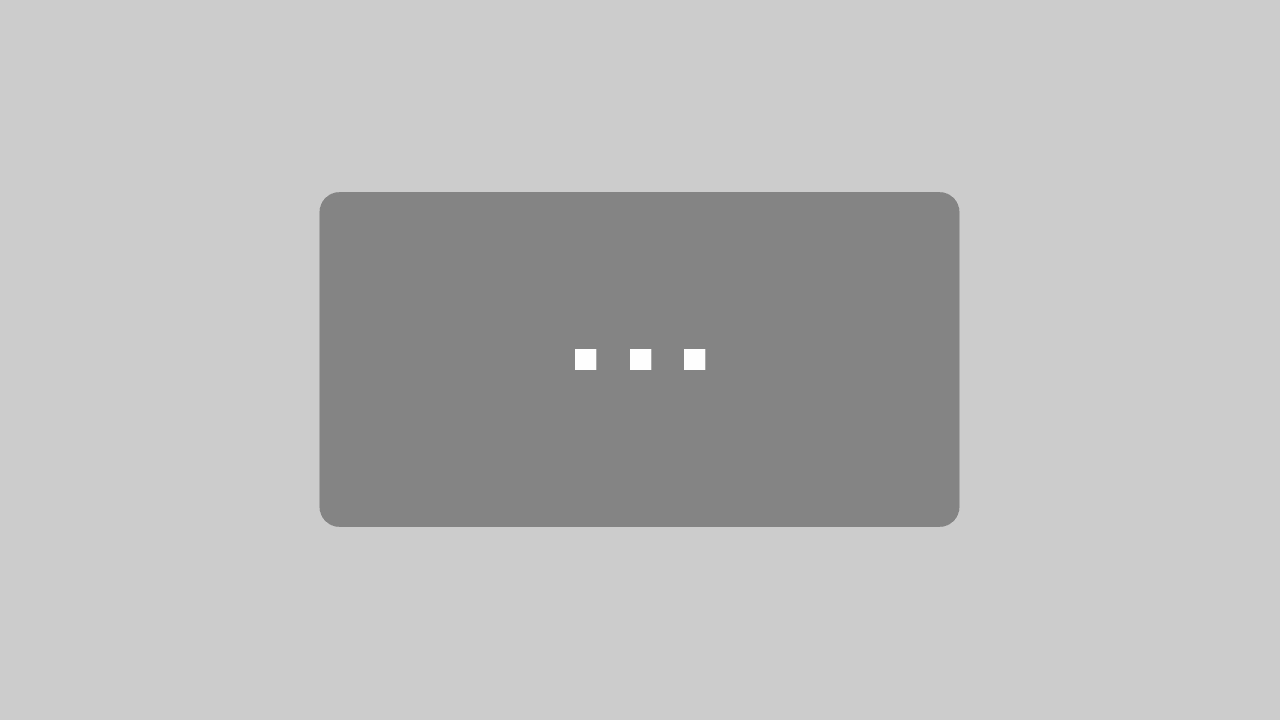Mit „Hamilton“ werden viele Superlative verbunden: Das Musical hat mehr als 50 Theaterpreise und Auszeichnungen erhalten, darunter elf Tony Awards und den Pulitzer Preis. Bereits im Vorverkauf setzte die US-Produktion 57 Mio. Dollar um und war nach der Uraufführung 2015 in den ersten Jahren ständig ausverkauft. Erfolgreich läuft das Stück seit Ende 2017 auch im Londoner Westend. Jetzt ist Lin-Manuel Mirandas Werk in Hamburg zu sehen – als erste nicht-englischsprachige Inszenierung. Die Premiere Anfang Oktober wurde mit Spannung erwartet. Aber auch mit Skepsis: Kann ein Stück über Aufstieg und Fall von Alexander Hamilton – einem der Gründungsväter der USA – in Deutschland funktionieren? Ein Stück, das als Hip-Hop-Musical Furore macht und jetzt mit deutschem Sprechgesang das Publikum erobern soll? Nach der umjubelten Premiere ist klar: Zumindest die Weichen dafür sind gestellt. „Hamilton“ beeindruckt auch in Hamburg.
Temporeich und energiegeladen
Das liegt sicherlich daran, dass „Hamilton“ die Geschichte der amerikanischen Revolution auf eine Art und Weise erzählt, die stellenweise selbst als revolutionär bezeichnet werden kann. Mit einem Genremix aus Rap, Jazz, Pop und Swing, einem Libretto mit mehr als 27.000 Wörtern und einem divers gecasteten Ensemble, das die Geschichte der weißen Gründungsväter erzählt, bewegt sich Hamilton auf neuen Wegen. Auch in Sachen Choreographie (Andy Blankenbuehler): Temporeich, energiegeladen und voller Hip-Hop-Anleihen sind sie zentraler Teil der Inszenierung (Regie: Thomas Kail). Sie erzählen, begleiten, kommentieren und visualisieren das Geschehen, den Rap, den Gesang. Das geschieht so fließend, das immer alles und alle in Bewegung zu sein scheinen. Verstärkt wird dieser Effekt durch eine in die Bühne eingelassene Drehscheibe, die sich jede Sekunde um 20 Grad dreht. Sie ist das Zentrum des ansonsten schlicht, aber sehr funktional gehaltenen Bühnenbilds, einem großem Holzgerüst mit Stiegen und Treppen vor einer dunklen Backsteinmauer.

Ein Wortkunstwerk
Die Hamburger Inszenierung von „Hamilton“ funktioniert aber auch, weil die Übersetzung des Librettos von Lin-Manuel Miranda außerordentlich gut ist. Rapper Sera Finale und Musicalautor Kevin Schroeder haben die insgesamt 47 Songs in 3,5 Jahren in die deutsche Sprache übertragen – mit viel Feingefühl für beide Sprachen, für Wortspiele und Wortwitz, für Anspielungen und Bilder. Eine Mammutaufgabe. Schließlich galt es nicht allein den Sinn in eine andere Sprache zu überführen. Auch Silbenzahl, Satzstruktur, Betonung und vor allem das Reimschema mussten passen. Herausgekommen ist ein eigenes Wortkunstwerk und gleichzeitig eine Verneigung vor dem Original. Die deutsche Übersetzung ist poetisch und intelligent. Hat Tempo und Witz. Schafft eindringliche Bilder und ideenreiche Metaphern. Einzelne englische Phrasen wie „Immigrants, we get the job done!“ oder „Talk less, smile more“ sind geblieben, Anspielungen an Songs der deutschen Hip-Hop-Szene hinzugekommen.
Dieses Sprachfeuerwerk erwecken die Darstellenden temporeich, pointiert und ausdrucksstark zum Leben – und mit ihm die Menschen, die die amerikanische Gründungsgeschichte prägten: ihre Wünsche, Hoffnungen, Zweifel. Ihre Sehnsucht nach Liebe und Freiheit.Ihren Hunger nach Macht. Als Alexander Hamilton zeichnet Benét Monteiro das vielschichtige Bild eines getriebenen, intelligenten und charmanten Mannes, der – mutig, aber auch ohne Rücksicht auf Verluste – für seine Sache einsteht. Sein Hamilton ist kein reiner Sympathieträger, sondern ein Politiker mit Stärken und Schwächen und ein Mensch, der an dem Tod seines Sohnes fast zerbricht.

Bestechende Darstellungen
Ihm gegenüber steht Aaron Burr. Erst Freund, dann politischer Gegenspieler, schließlich der Mann, der Hamilton im Duell tötet. Gino Emnes gibt den ehrgeizigen, heuchlerisch auf seine Chance wartenden und später von Neid und Machthunger getriebenen Kommentator des Geschehens mit einnehmender Präsenz und markanter Stimme. Gesanglich hervorragend ist auch Ivy Quainoo, die eine starke, gefühlvolle Eliza Hamilton zeigt. Chasity Crisp berührt als Angelica Schuyler in den leisen Momenten zutiefst und begeistert mit kraftvollem Gesang, während Mae Ann Jorolan als junge Schuyler-Schwester Peggy und später als verführerische Mae Ann Jorolan gleichermaßen zu überzeugen weiß. Hassfigur der Revolutionäre ist der britische King George, den Jan Kersjes grandios als exaltierte, leicht psychopathische Witzfigur anlegt. Für seine pointiert-komische, in Mimik und Gestik absolut bestechende Darstellung bekam er begeisterten Szenenapplaus.

Nach 2,5 Stunden waren Applaus und Jubel dem gesamten Ensemble sicher: Kaum war der letzte, von dem zehnköpfigen Orchester unter Leitung von Philipp Gras gespielte Ton verklungen, standen die Zuschauer:innen im Saal. Mit „Hamilton“ findet ein besonderes, modernes und gelungen anderes Musical seinen Weg in die deutsche Musicalszene, das auch hierzulande hoffentlich sein Publikum findet. Verdient hätte es das.